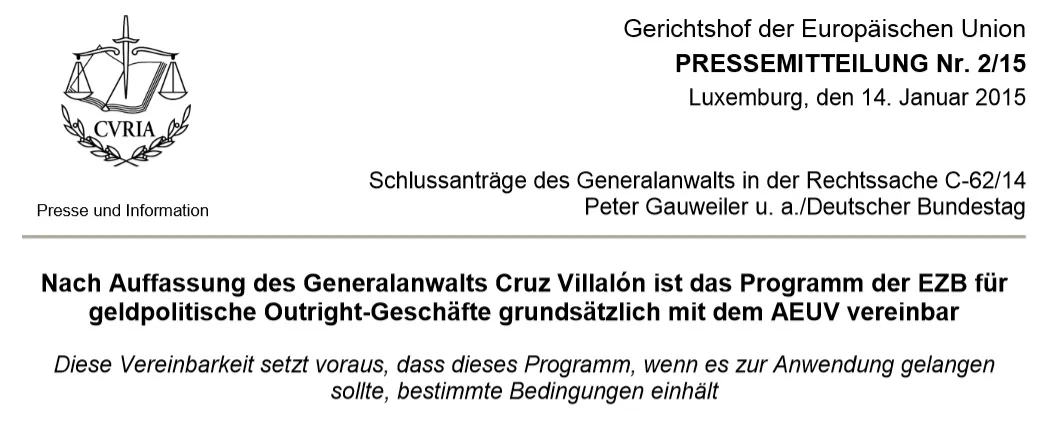Die Geschichte von Céline war vielfach in der Presse zu lesen: Am 20. März 2008 erlitt die 17-jährige Frau eine schwere beidseitige Lungenembolie, was zu einem Herzstillstand und schweren Hirnschäden führte. Seither kann Céline nicht mehr sprechen und muss künstlich ernährt werden. Nach umstrittener Auffassung stellt die Einnahme des hormonellen Verhütungsmittels "Yasmin" die Ursache der Embolie dar; diese wurde Céline drei Monate vor dem Unglück von einem Arzt verschrieben.
Das Bundesgericht hat nun letzten Mittwoch die Begehren um Schadenersatz und Genugtuung über eine Summe von mehr als 5,7 Mio. Franken abgewiesen. Gleich entschieden haben zuvor das Bezirksgericht und Obergericht des Kantons Zürich. So tragisch die Umstände auch sind: Diese Entscheide erscheinen als richtig.
Die Pille ist offensichtlich nicht "sicher"
Nach dem Massstab des Produktehaftpflichtgesetzes sei das Medikament nicht fehlerhaft. Gar nicht geprüft wurde die Zulassung des Medikamentes: Für diese muss das Arzneimittel qualitativ hoch stehend, sicher und wirksam sein (Art. 10 HMG). Nun zeigen statistische Daten, dass Thrombosen als mögliche Auslöser von Lungenembolien eine bekannte, aber seltene Nebenwirkung von hormonellen Verhütungsmitteln sind. Die Packungsbeilage weist auf diese Nebenwirkung hin. Das Produkt ist also offensichtlich nicht "sicher". War die Zulassung also ein Fehler?
Absolute Sicherheit gibt es nicht
Der Gesetzgeber, der Bundesrat und die Swissmedic sagen uns nichts zur erforderlichen Sicherheit. Über das Restrisiko erfahren wir erst etwas in internationalen Richtlinien. Danach ist eine Zulassung zu verweigern, wenn eine "nicht unerhebliche potentielle Gefahr für die öffentliche Gesundheit" besteht. Die absolute Sicherheit eines Medikamentes wird nicht verlangt; das akzeptierte Risiko ist abhängig von der Wirksamkeit des Medikamentes. Der Zulassungsentscheid erfordert damit eine Güterabwägung: Die mit einer ungewollten Schwangerschaft verbundenen Risiken sind mit den Risiken der Einnahme des Arzneimittels abzuwägen. In beiden Fällen erleiden Menschen Schäden oder sterben sogar, was nicht verhindert werden kann.
Zu berücksichtigen ist ferner, dass Zulassungsentscheide fehlerhaft sein können. Wirksame Arzneimittel werden also unter Umständen nicht zugelassen, obwohl die Bedingungen erfüllt wären. Auch werden unwirksame oder unsichere Medikamente manchmal zugelassen, was nicht passieren sollte. Schliesslich benötigt das Zulassungsverfahren Zeit (über ein Jahr); während dieser Zeit stehen wirksame Medikemente zur Behandlung von Krankheiten nicht zur Verfügung. Eine strengere Zulassungsprüfung für Medikamente rettet also nicht zwingend menschliches Leben. Fehler sind daher unvermeidbar und haben unter Umständen schwere Gesundheitsschäden oder Tote zur Folge.
Verantwortung für die Opfer der Risikogesellschaft
Es ist schwer zu akzeptieren, dass eine hochentwickelte Gesellschaft Risiken nicht gänzlich aussschliessen kann. Es ist ethisch noch schwerer zu erklären, dass eine Gesellschaft Opfer quasi in Kauf nehmen muss. Reflexartig wollen wir nach den Verantwortlichen fahnden und die Schuldigen bestrafen. Jedoch gibt es keine "Schuld", wo sich ein gesellschaftlich akzeptiertes Risiko als Schaden manifestiert. Wir wussten um das Risiko, und dass sich die Inkaufnahme dieses Risikos im Einzelfall als äusserst tragisch erweisen kann. Es wäre in dieser Situation falsch, eine Kompensation zuzusprechen, nur weil der Risikoverursacher in der Lage ist, diese Kompensation zu zahlen. Vielmehr ist es Aufgabe der gesamten Gesellschaft, sich den Opfern der von ihr akzeptierten Risiken anzunehmen. Die Gesellschaft erfüllt diese Aufgabe nicht durch Zahlung grosses Summen im Einzelfall, sondern durch ein ausgebautes Sozialversicherungsnetz. Mehr sollte nicht verlangt werden.
St.Gallen, 23. Februar 2015


![EZB mit Mainpanorama, von Simsalabimbam [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/51470f2fe4b0b35e942df713/1421238124570-0IRTD63U6IQ7CY1QGK9G/image-asset.jpeg)