Der Nationalrat hat am Dienstag eine Motion seiner Kommission (KVF-N) abgelehnt, die dem Parlament mehr Einfluss bei der Formulierung der Konzession der SRG gegeben hätte. Rechtzeitig vor der Debatte ist ein warnender Gastbeitrag des renommierten SRG-Journalisten Caspar Selg in der NZZ erschienen: "Der direkte Zugriff der Politik auf die Medien ist das Kennzeichen von autoritären Regimen. Eine vom Parlament gesteuerte SRG wäre ein Schritt genau in diese Richtung." Selg erinnert schon im ersten Satz an "Orban, Erdogan, Duterte, Trump." Auch Bundesrätin Doris Leuthard warnte "vor Politikeinfluss", im Einklang mit dem Generaldirektor der SRG Roger de Weck. Aus staatsrechtlicher Sicht sind die hier vorgebrachten Argumente jedoch völliger Blödsinn.
Allgemeiner Konsens herrscht offensichtlich darin, dass ein "öffentliches Medienhaus" (Wortkreation von de Weck) staatsfern zu organisieren ist. Auch bei staatsfernen Medien braucht es jedoch eine Instanz, welche in irgendeiner Art die von diesem Medienhaus erwarteten Leistungen definiert. Bei knappen öffentlichen Ressourcen ist es schlicht nicht rechtfertigbar, einer Institution CHF 1,2 Milliarden in die Hand zu drücken mit den Worten: "Jetzt mach mal!". Wenn wir also über mögliche politische Einflussnahmen diskutieren wollen, dann müssen wir die für die Leistungsdefinition alternativ zur Verfügung stehenden Institutionen anschauen. Mit anderen Worten: Wenn es das Parlament nicht machen soll, wer dann?
Offensichtlich bevorzugt die SRG bei der Leistungsdefinition den Bundesrat. Gerade dieser stellt jedoch als Exekutive die eigentliche "politische" Gewalt dar; er ist nur indirekt demokratisch legitimiert. Es ist das Parlament, das direkt vom Volk gewählt ist, das alle gesellschaftlichen Strömungen und auch kleine Parteien enthält und das heute schon im RTVG den Rahmen der SRG-Konzession vorzeichnet. Auch im historischen Rückblick fanden unzulässige politische Einflussnahmen doch selten ihren Ursprung im Parlament. Wenn Caspar Selg vor Orban, Erdogan, Duterte und Trump warnt, so übergeht er in unerklärbarer Weise, dass diese Personen alle der Exekutive angehören und daher in der Schweiz dem Bundesrat entsprechen würden.
Vielleicht versucht man schon zu viel in den Gastbeitrag von Selg hineinzulesen, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass der Redaktor für internationale Politik Nicolás Maduro nicht erwähnt, den sozialistischen Autokraten von Venezuela. Dennoch stellt sich hier die Frage, ob die klar fehlerhafte Argumentation von Selg nicht einfach politisch bequem ist. Würde Selg das derzeitige institutionelle Setting gleich vehement verteidigen, wenn wir eine Mitte-Rechts-Regierung hätten und eine Mitte-Links-Mehrheit im Parlament? Man kann leicht erahnen, dass dann eine Einflussnahme des Parlaments nicht mehr das Label "politisch", sondern "demokratisch" erhielte.
St.Gallen, 17. März 2017
Zusammen mit dem Ökonom Mark Schelker hat sich der Autor dieses Blogs im Buch "Medien im digitalen Zeitalter" mit den Herausforderungen bei der Neugestaltung der zukünftigen Medienlandschaft auseinandergesetzt. Er spricht heute zu diesem Thema an den 9. Aarauer Demokratietagen des Zentrums für Demokratie Aarau.


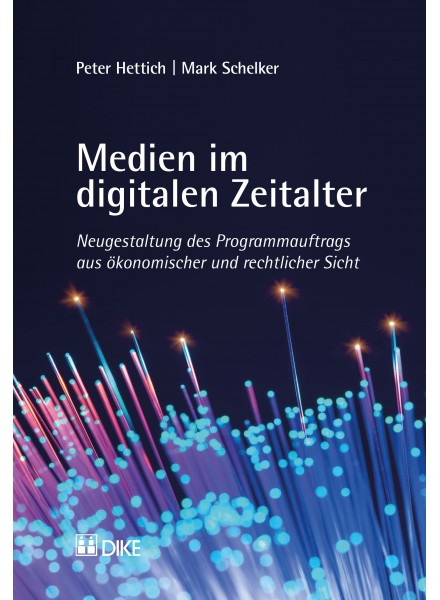
![Letzte Taxis? (Foto von Kevin.B [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons)](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/51470f2fe4b0b35e942df713/1484204378675-MA7TX6PE75L3Z3UYU5Z4/image-asset.jpeg)
![By Longlivetheux (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/51470f2fe4b0b35e942df713/1479299194667-HZCOMZM8NZYQV0383YMQ/image-asset.png)