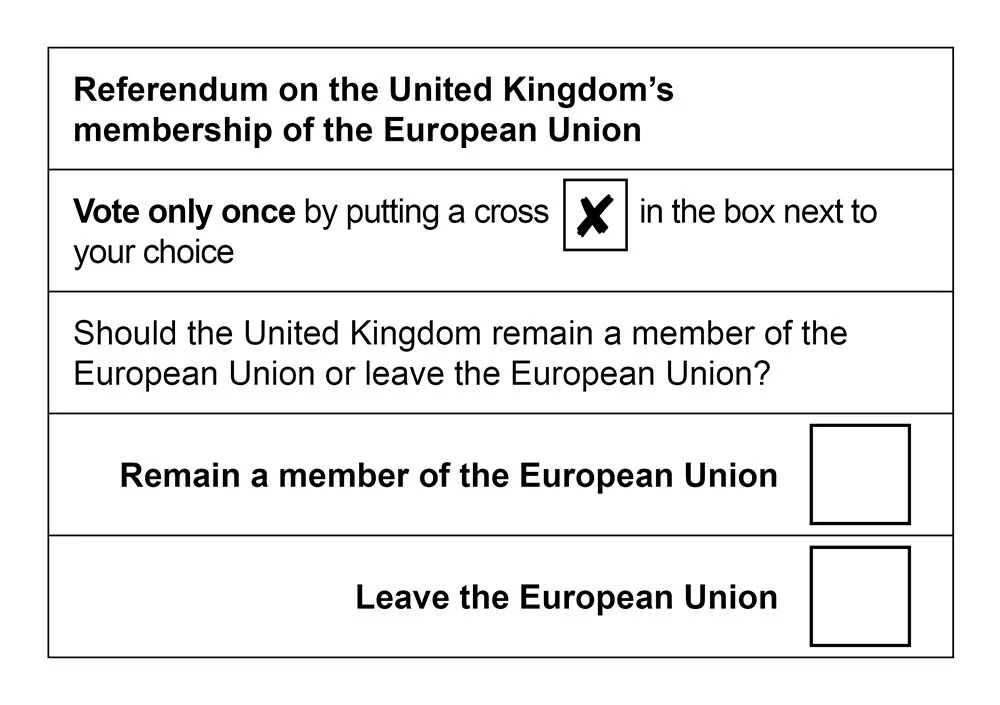Gestern führte mich ein nicht weiter tragisches Alltags-Wehwehchen zum Arzt. Ich hatte das schonmal, die Akte sagt es war vor sechs Jahren, und dem Arzt war schnell klar, welches Medikament (wiederum) Abhilfe schaffen würde. Ein rezeptpflichtiges Medikament natürlich, eingeteilt in Abgabekategorie A (Art. 23 VAM): Der Gang zum Arzt ist bei solchen Wirkstoffen unabdingbar, denn in dieser Abgabekategorie wird auch die vom Parlament am 18. März 2016 beschlossene Vereinfachung der Selbstmedikation nichts bringen. Die Referendumsfrist für diese Änderung des HMG ist just gestern unbenutzt abgelaufen. Die Änderung soll dazu führen, dass Medikamente vermehrt auch von Apothekern oder Drogisten bezogen werden können oder gar frei verkäuflich sind. Wer den sofgältigen Umgang z.B. mit Antibiotika als schützenswertes Kollektivgut ansieht, wird an der Beibehaltung der Verschreibungspflicht keinen Anstoss nehmen.
Anstoss nimmt der mündige Konsument eher darin, dass er das benötigte Medikament nicht vom Arzt selber kriegt, sondern den Gang in eine Apotheke auf sich nehmen muss. Die Debatte um die Medikamentenabgabe durch die Ärzte ist älter als das Heilmittelgesetz selbst. Was mir als Patient mehr als überflüssig erscheint, wird mir von den Apotheken als zusätzlicher Schutz vor dem Arzt verkauft, der in Sachen Medikamente nicht genügend ausgebildet sei. Die so erbrachte Beratungs-Dienstleistung, die der Patient stoisch erdulden muss, lässt sich der Apotheker auch vergolden. Das CHF 9.55 teure Präparat kosten mit dem "Medikamenten-Check" von CHF 4.30 und dem "Bezugs-Check" von CHF 3.25 nun fast doppelt soviel. Schön lässt sich der Konsumentenschutz predigen, wenn man diesen auch teuer verkaufen kann. Für mehr Kosteneffizienz im Gesundheitswesen, so scheint es, gäbe es durchaus Raum, ohne gleich der Rationierung und Zweiklassenmedizin das Wort reden zu müssen.
St.Gallen, 8. Juli 2016

![Darstellung: Apotheke, gezeichnet von G. Locher (1730 - 1795) (1774), graviert von Bartholomäus Hübner (1775) [Public domain], via Wikimedia Commons](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/51470f2fe4b0b35e942df713/1467895033292-EU72ZBUM7F4QIM67UZJQ/image-asset.jpeg)