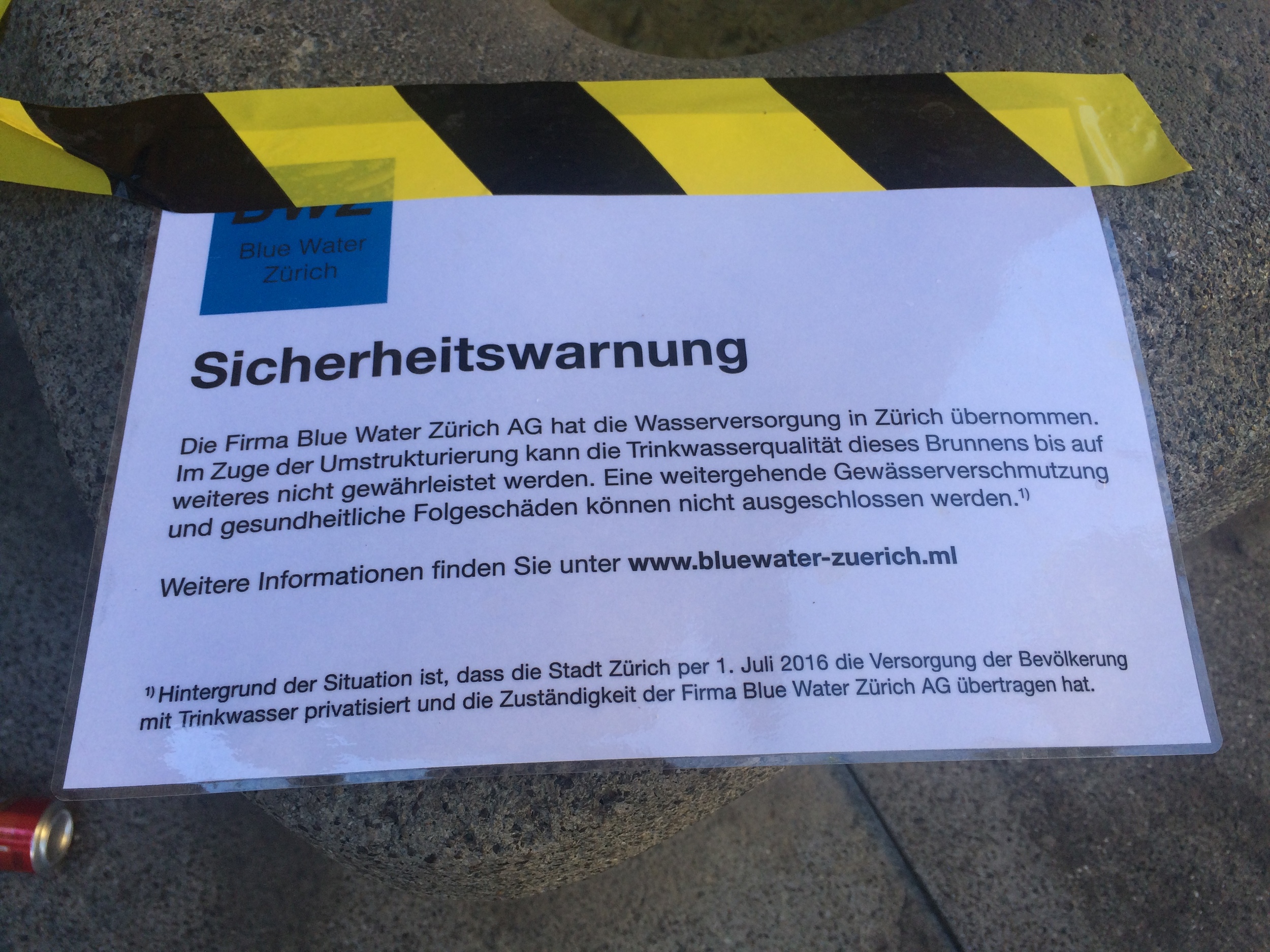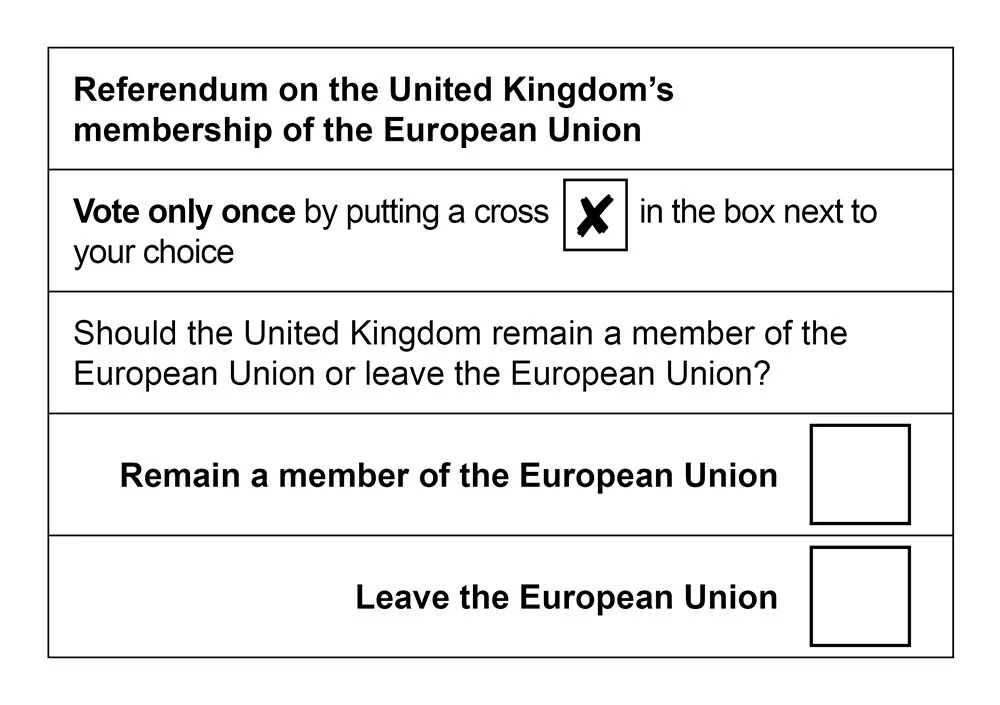Der Bundesrat hat im Juni einen Bericht zu privaten Verschuldungsanreizen im Steuerbereich zur Kenntnis genommen. Dieser untersucht, inwieweit Privatpersonen einen Anreiz haben, sich im Hypothekarbereich aufgrund der steuerlichen Situation zu verschulden, welche Risiken sich daraus ergeben sowie wie diesen Fehlanreizen begegnet werden könnte. Im Juli konnte man dann von einem Vorstoss der Zürcher SP lesen, die es Verschuldeten ermöglichen soll, ihre Einkommenssteuern direkt und im Vorfeld per Lohnabzug zu bezahlen. Ein Verhaltensökonom bestätigt den positiven Effekt, da doch einige Leute nicht in der Lage seien zu berücksichtigen, dass sie von ihrem Lohn noch die Steuern zahlen müssen.
Wenn es um die Vernunft der Schweizer so schlecht bestellt ist, dann fragt man sich, wieso der Bundesrat es im Bereich der Konsumkredite für notwendig gehalten hat, den Höchstzinssatz per 1. Juli 2016 von 15% auf 10% zu senken. Setzt er damit nicht auch einen massgeblichen Verschuldungsanreiz für die Privathaushalte? Die Inkonsistenz erklärt sich dadurch, dass der Bundesrat in diesem Bereich "einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen der Schuldenprävention (recte wohl: der Schuldner) einerseits und denjenigen der Kreditinstitute andererseits" schaffen möchte. Statt darauf zu vertrauen, dass der Wettbewerb zu einem angemessenen Konsumkreditzinsniveau führen würde, möchte der Bundesrat also lieber selbst den "gerechten" Preis für Kredite festsetzen.
Was die Aktivitäten im Bereich Steuern und Konsumkredite also verbindet, ist nicht der Wille zur Bekämpfung von Verschuldungsanreizen, sondern der Glaube, komplexe Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft effektiv und effizient steuern zu können.
St.Gallen, 22. Juli 2016

![Bild von Aliman Senai (Eigenes Werk) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/51470f2fe4b0b35e942df713/1468421341193-FWKJL11HM3MEJ6OX1B3V/image-asset.jpeg)