Letzten Samstag hat Rainer Stadler die Diskussion um den "Service Public" im Mediensektor gelungen zusammengefasst. Auch die vom Ökonomen Mark Schelker und mir verfasste Studie (im Auftrag des Verlegerverbands) wird freundlicherweise im Artikel besprochen (gestern im Dike Verlag erschienen). Rainer Stadler macht im Kampf um den künftigen Service public vier Fraktionen aus: "die Abschaffer, die Reduktionisten, die Umverteiler und die Besitzstandwahrer." Er dürfte unser "professorales Papier" wohl zu den Reduktions- und Umverteilungs-Ansätzen zählen. Ich würde dagegen sagen, dass wir in erster Linie für eine Öffnung der Chancen auf Förderung plädieren.
Wir erscheinen als Reduktionisten, weil wir den Programmauftrag im digitalen Zeitalter nur noch als beschränkt notwendig ansehen. Einen "Versorgungsmangel" könnte man allenfalls bei der Produktion von politischen Informationen ausmachen. Die Notwendigkeit einer staatlich finanzierten Vollvorsorgung mit Informationen war vielleicht vor 50 Jahren gegeben - heute jedoch nicht mehr. Es ist jedoch nicht an den Professoren, über das Ausmass der Medienförderung zu entscheiden. Vielmehr sehen wir es als Aufgabe des demokratisch legitimierten Gesetzgebers an, ein Budget für die Förderung festzulegen und dieses referendumsfähig im Gesetz zu verankern.
Wir erscheinen als Umverteiler, weil wir die Förderung öffnen wollen. Natürlich schafft eine solche Öffnung Chancen für andere Medien- und Kulturschaffende, die mit ihren Inhalten positive gesellschaftliche Effekte erzielen. Und natürlich verlangt eine Öffnung des Fördertopfes von der SRG grössere Anstrengungen ab, da die Höhe der Subventionen nicht mehr von vorneherein garantiert ist. Ob es aber tatsächlich zu einer Umverteilung kommt, hängt gemäss unserem Vorschlag von den tatsächlichen Leistungen der einzelnen Akteure ab. Diese Leistungen müssen nicht nur qualitativ hochstehend sein, sondern beim Publikum auch Anklang finden. Wie zuvor ist es also nicht an den Professoren, vorgängig Kriterien für die Förderungswürdigkeit von Inhalten zu definieren. Statt einen neuen Status Quo bei der Medienförderung zu zementieren, wollen wir vielmehr einen dynamischen Prozess verankern, der offen für innovative Service-Public-Formate ist.
Das heutige Medienförderungskonzept ist aus unserer Sicht nur noch historisch erklärbar. Es erscheint im digitalen Zeitalter mit seinem Überfluss an Übertragungskapazität, Plattformen und Informationen nicht mehr als zeitgemäss. In der kommenden Debatte um die audiovisuelle Grundversorgung wird sich zeigen, ob das Parlament den Service Public für das Zeitalter des Internets neu denken wird.
St.Gallen, 17. Juni 2016
Klappentext: Die Digitalisierung hat die Medienmärkte grundlegend verändert. Informationen werden heute nicht mehr nur über Print, Radio und Fernsehen verbreitet, sondern in verschiedensten Formaten auch über das Internet. Diese technische Entwicklung lässt die unterschiedlichen Medien konvergieren. Die privaten Medien und die staatlich subventionierten audiovisuellen Angebote der SRG stehen heute untereinander in intensivem Wettbewerb. Dies führt zu erheblichen Marktverzerrungen, die die Medienvielfalt je länger, je stärker bedrohen.
Die heute bestehende rechtliche Medienordnung hinkt den tatsächlichen Entwicklungen hinterher und trägt den bedeutenden Umwälzungen in den Medienmärkten nicht Rechnung. So war die Subventionierung eines einzelnen audiovisuellen Anbieters in den Anfängen wohl noch notwendig, doch sind die finanziellen Hilfen heute überholt und schädlich. Die Sicherstellung eines vielfältigen und unabhängigen Medienangebots, welches sich der Informationsvermittlung im politischen Prozess verschreibt, ist eine wesentliche Grundlage für die freie Meinungsbildung in der Bevölkerung, und damit für das Funktionieren unserer Demokratie. Diese grundlegende Bedeutung der medialen Berichterstattung kann eine staatliche Unterstützung der Medien aus ökonomischer und rechtlicher Sicht rechtfertigen.
Dieses Buch diskutiert die bestehenden Formen der Förderung aus ökonomischer und rechtlicher Sicht. Die Autoren schlagen eine innovative Neugestaltung des Programmauftrags sowie eine politisch unabhängige und wettbewerbliche Medienförderung für das digitale Zeitalter vor. Das Buch stellt damit einen Diskussionsbeitrag in der laufenden Diskussion um die Reform der Service-Public-Medien dar; es richtet sich an Politiker, Behördenmitglieder, Medienwissenschafter, Ökonomen und Juristen.

![von Norbert Bangert (Eigenes Werk) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/51470f2fe4b0b35e942df713/1466084155933-3JY58ZUZCTLJV72BHWF1/image-asset.jpeg)
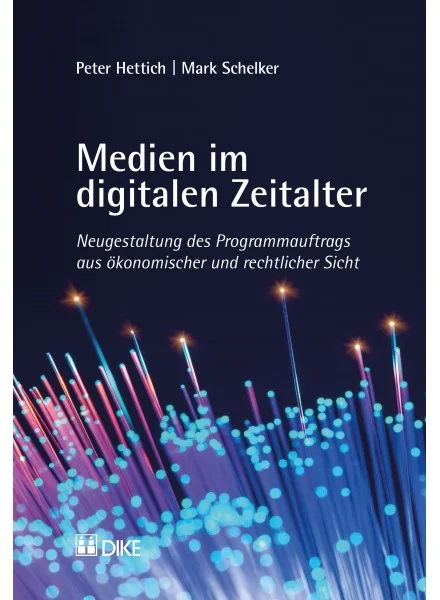

![Foto: International Students’ Committee [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/51470f2fe4b0b35e942df713/1462961110910-EGKM1GZ2BIA5QU4VY861/image-asset.png)