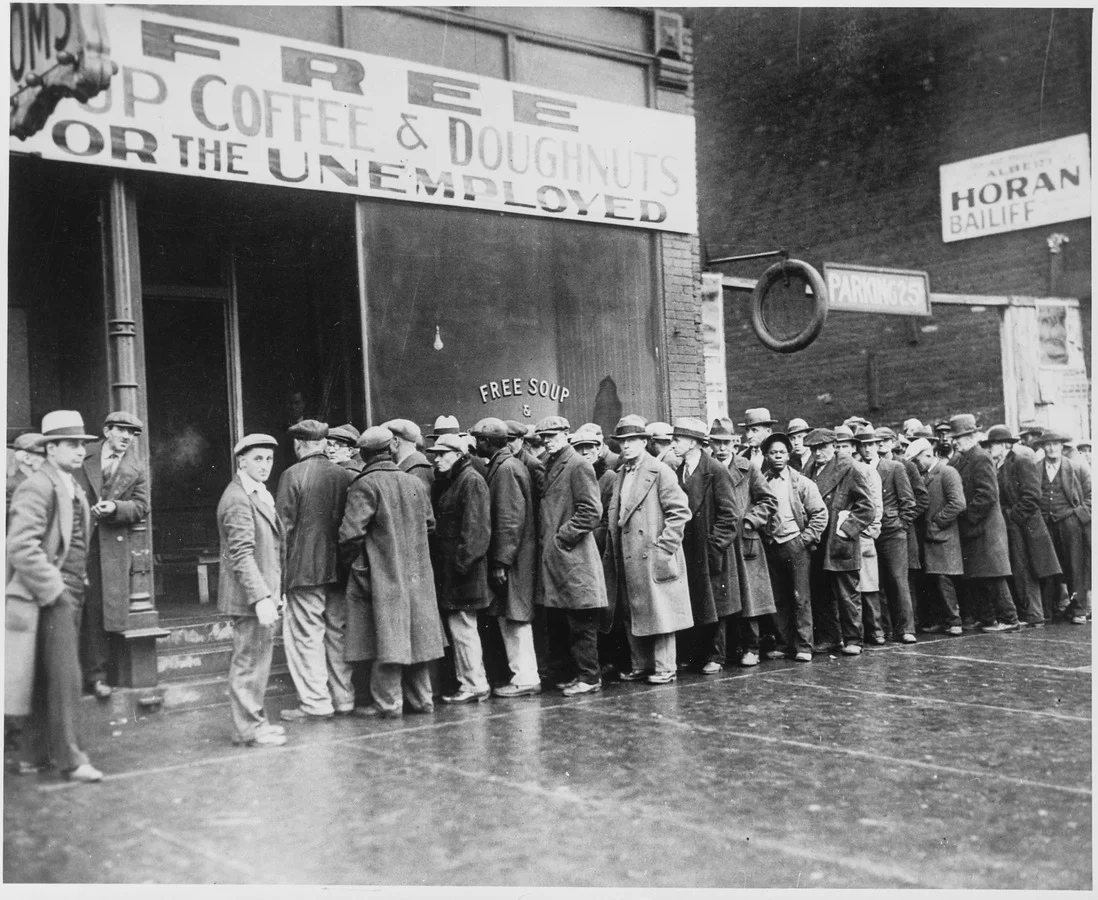Gestern hat die Schweizerische Post in einer Pressemitteilung angekündigt, dass Sie ihr Angebot an Drittprodukten in den Filialen überprüfen und allenfalls anpassen möchte. Mit einem Umsatz von knapp einer halben Milliarde Franken würden die Drittprodukte eine wichtige Säule in der Finanzierung des Poststellennetzes darstellen, berichtet der Tagesanzeiger. Das Angebot von Drittprodukten wird dennoch immer wieder kontrovers diskutiert, weshalb die Post die Akzeptanz dieses Angebots stärken möchte.
Auch in diesem Blog wurde schon festgestellt, dass die Post alles Mögliche verkauft, nur keine "Stopp Werbung"-Aufkleber. Doch wurde auch gewarnt, zu einer Post zurückzukehren, die zwar funktioniert, aber nicht rentiert. Das Finanzergebnis der Post war vor 20 Jahren noch schlicht "katastrophal" (Ulrich Gygi). Insofern stimmen die jüngsten politischen Vorstösse skeptisch: Die parlamentarische Initiative von Rudolf Joder (14.414) mit dem Namen "Die Post soll sich auf ihren Unternehmenszweck konzentrieren und nicht immer mehr Krimskrams verkaufen" hat zwar einen äusserst kreativen Titel. Dennoch will die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen wohl zu recht, wenn auch nur knapp mit 13:12 Stimmen, entsprechende Änderungen im Postorganisationsgesetz nicht unterstützen. Dieselbe Kommission verlangt jedoch in einem am 23. März 2015 verabschiedeten Postulat (15.3377), dass der Bundesrat über die strategischen Ziele das Angebot von Drittprodukten beschränkt.
Will man das Angebot von Drittprodukten nicht rundweg verbieten, so scheint es extrem schwierig, die Balance zwischen den gewollten unternehmerischen Freiheiten für die Post und unnötigen Wettbewerbsverzerrungen zulasten der privaten Unternehmen in benachbarten Märkten zu finden. Weder das formelle Gesetz noch die strategischen Ziele scheinen besonders geeignete Instrumente zu sein, diese Balance im Detail und immer wieder neu zu herzustellen. Will man diesen Konflikt vollständig auflösen, so bleibt nur eine Option: die Aufhebung von Art. 6 POG und damit die Privatisierung der Post. Für die Swisscom hat der Bundesrat aber einen solchen Schritt erst letzten November "vorläufig" ausgeschlossen.
St.Gallen, 9. April 2015


![W.J.Pilsak [GFDL oder CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/51470f2fe4b0b35e942df713/1427966347696-BOXQOH8XUXS1CEBXFKGZ/Checkmate2.jpg)