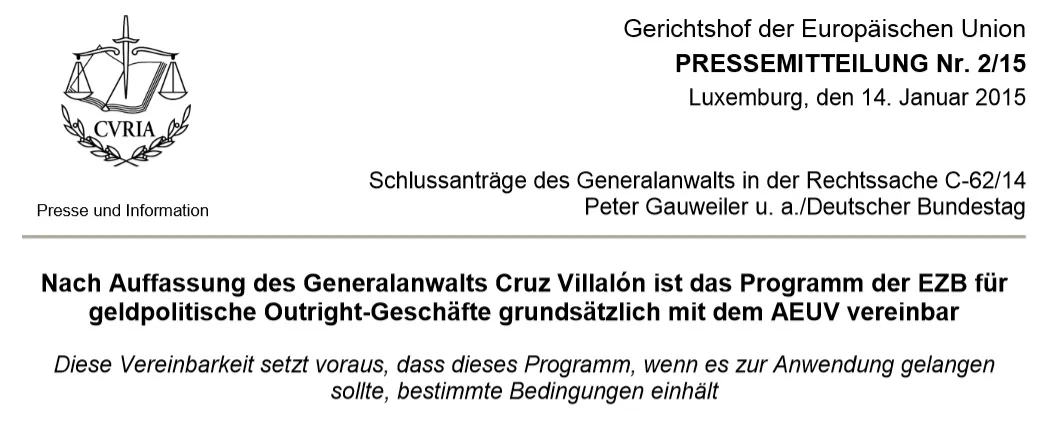Jogging bei kalter Witterung ist eine Freude, jedenfalls mit guter Ausrüstung und einem anschliessenden heissen Bad. Ein Bad verbraucht 5 kWh Energie. Es kostet mich 1.60 Fr., wenn ich das Wasser mit Strom im Öko-Plus-Hochtarif der St.Galler Stadtwerke erwärme; billiger ist es mit Erdöl. Der Preis ist wahrlich nicht zu hoch nach einer Anstrengung; energiepolitisch handle ich jedoch verwerflich. Der Bundesrat und Nationalrat wollen den Energieverbrauch pro Person und Jahr deutlich senken; dazu leistet nur einen Beitrag, wer sich mit Duschen begnügt und auf das Baden verzichtet.
Wollen wir die Ziele der Energiestrategie 2050 insgesamt erreichen, so werden wir uns auch in vielen anderen Bereichen umstellen müssen: Das Verbot herkömmlicher Glühbirnen und leistungsstarker Staubsauger ist nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, was uns erwartet. Mit Schummerlicht aus Energiesparlampen, nichtsaugenden Staubsaugern und Rinnsalen aus wassersparenden Duschköpfen werden sich vermutlich nur wenige Idealisten freiwillig abfinden. Bei einem Preis von 1.60 Fr. habe ich selbst jedenfalls kaum Anreize, auf mein heisses Bad oder andere Annehmlichkeiten eines modernen Lebens zu verzichten.
Suffizienz als Hinwendung zum einfachen, genügsamen Leben
Die Senkung des Energieverbrauchs ist kein einfaches Unterfangen. Was die Schweiz hier vorhat, haben nur Länder «geschafft», die in Bürgerkriege oder sonst anarchistische Zustände verfallen sind. Anschaulich wird dies, wenn Ökonomen die Wohlfahrt eines Landes an seinem Elektrizitätsverbrauch messen, wie z.B. HSG-Kollege Roland Hodler mit seinen Analysen der nächtlichen Lichtintensität (Der Blick auf ein Satellitenbild von Nord- und Südkorea zeigt, was ich meine). Wer also Effizienzgewinne in der von der Politik nun angestrebten Grössenordnung realisieren will, der rechnet mit Innovationen, die teilweise noch nicht einmal am Reissbrett skizziert sind. Hoffnung bleibt: So hat uns die LED vor den schaurigen Energiesparlampen gerettet, die uns die Politik aufgenötigt hat.
Die durch die Energiestrategie 2050 angestrebte Senkung des Energieverbrauchs ist nicht allein einer Steigerung der Energieeffizienz zu erreichen. Effizienz würde bedeuten, unseren gewohnten Lebensstandard mit einem tieferen Energieverbrauch zu bestreiten. Bundesrat und Nationalrat streben jedoch darüber hinaus nach Sparsamkeit. Suffizienz ist das Stichwort, also eine generelle Einschränkung des Verbrauchs an Energie, Wohnfläche, Material und sonstigen Ressourcen.
Sparsamkeit erfordert ein Umdenken
Sparsamkeit als solche ist ein durchaus vernünftiges Konzept; doch verlangt konsequente Suffizienz ein grundsätzliches Überdenken der eigenen Lebensform, Wertvorstellungen und Bedürfnisse: Die ökologische Philosophie der Suffizienz fordert eine Hinwendung zu einem «einfachen Leben», den «Verzicht auf Besitz und ein Gewinn an Zeit», «weniger kaufen und mehr tauschen, teilen, selber machen, anpflanzen und reparieren», «weniger weit reisen und stattdessen die Nähe und den Charme der Langsamkeit entdecken», «weniger Fleisch und mehr Vegetarismus/Veganismus», etc.
Suffizienz ist im Grunde genommen eine Abkehr vom Glauben, dass Probleme allenfalls auch durch menschliche Innovationskraft zu lösen sind. Genau diese Radikalität der Suffizienz-Philosophie erklärt vermutlich, warum der Bundesrat das S‑Wort kein einziges Mal in seiner Energiestrategie 2050 verwendet. Diese Auslassung ist nicht unerheblich: Zwar benutzt nun eine Bundesrätin medienwirksam einen «Tesla S» als Dienstwagen, doch darf diese Zukunftsperspektive für das Gros der Bevölkerung – ohne Widerspruch zur Suffizienz‑Philosophie – niemals Realität werden.
Suffizienz als Abkehr von etablierten energie-, wirtschafts-, und wohlfahrtspolitischen Grundsätzen
Es gibt zwei Wege zur Suffizienz: Wie Urs Birchler in seinem mit verschiedenen Ökonomen betriebenen Blog angedeutet hat, geht der eine Weg über den Preis. Gemäss dem Bundesamt für Energie wäre der Elektrizitätspreis mindestens zu verdoppeln, um eine nennenswerte Senkung des Verbrauchs zu erzielen. Wenn ich 4 oder gar 10 Fr. zahlen müsste, würde ich auf mein heisses Bad nach dem Jogging vielleicht verzichten (vielleicht auch nicht). Der Weg über den Preismechanismus ist allerdings viel zu einfach und vernünftig, als dass er politisch infrage käme.
Eine allgemeine Energiepreiserhöhung wirft nämlich Fragen der Verteilungsgerechtigkeit auf, die von den Befürwortern des Suffizienz-Modells gescheut werden: Es darf ja nicht sein, dass sich am Ende nur noch die Vermögenden eine grosse Wohnung, ein dickes Auto und ein heisses Bad leisten können. Die Politik geht mit der Energiestrategie 2050 also einen anderen Weg, der in eine Rationierung sowie eine zentrale Verwaltung und Zuteilung der «Energie‑Verbrauchsrechte» durch den Staat mündet. Eine erstaunliche Vorgehensweise für ein Gut, das an sich im Überfluss und kostengünstig für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen könnte. Mit dem Suffizienzgedanken wächst nun also auch zwangsläufig die Bedeutung des Staates in den Energiemärkten, bis anhin ohne nennenswerten Widerstand: An den wie Unkraut aus dem Boden geschossenen Energietagungen liefern heute jedenfalls Vertreter von UVEK, BFE und ElCom die «Keynote» – nicht mehr die CEOs der arg gebeutelten Energiewirtschaft.
Ungeachtet der ökonomischen Sinnhaftigkeit der Energiestrategie 2050 steht Suffizienz jedoch für eine Abkehr von etablierten energie-, wirtschafts-, und wohlfahrtspolitischen Grundsätzen. Diese Grundsätze sind in unserer Bundesverfassung niedergelegt; ihre Änderung bedarf einer legitimierenden Zustimmung von Volk und Ständen. Der Bundesrat vertritt leider die Auffassung, dass die Verwirklichung der Energiestrategie 2050 im Rahmen der geltenden Verfassung möglich ist. Es wäre am Parlament – als Hüterin der Verfassung – festzustellen, dass dies nicht der Fall ist. Der durchaus notwendige energiepolitische Wandel ist nur zusammen mit der Bevölkerung zu erreichen; als Elitenprojekt ohne demokratische Legitimation muss die Energiestrategie scheitern.




![EZB mit Mainpanorama, von Simsalabimbam [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/51470f2fe4b0b35e942df713/1421238124570-0IRTD63U6IQ7CY1QGK9G/image-asset.jpeg)