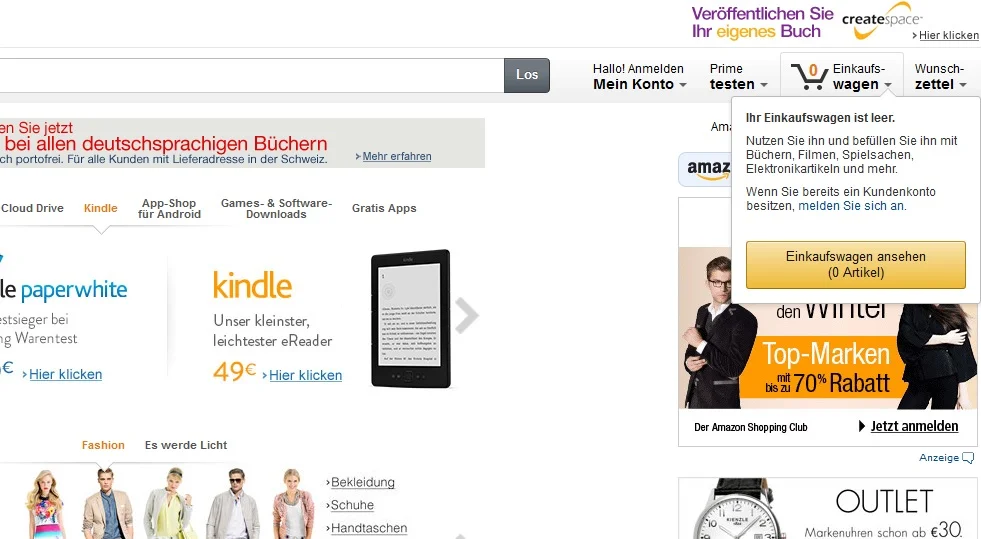Vor einer Woche hat der Bundesrat eine Medienmitteilung versandt, wonach er die Einführung eines allgemeinen Widerrufsrechts bei Telefon- und Fernabsatzverträgen begrüsst. Er will ein 14-tägiges Widerrufsrecht für Verträge unterstützen, die geschlossen werden, ohne dass sich die Vertragsparteien physisch begegnen. Weil die Konsumenten bei solchen Verträgen überrascht oder überrumpelt würden und oft den Vertragsgegenstand vor dem Vertragsschluss nicht prüfen könnten, bestehe ein erhöhtes Schutzbedürfnis.
Hintergrund des Geschäfts ist eine Parlamentarische Initiative des damaligen Ständerats Pierre Bonhôte. Diese will das Obligationenrecht (OR) so ändern, dass das für Haustürgeschäfte geltende Widerrufsrecht (Art. 40a ff. OR) neu auch für am Telefon geschlossene Verträge gelten soll. Damit soll den Missbräuchen beim Telefonverkauf ein Ende gesetzt werden.
Spannend erscheint, dass sowohl die Kommission für Rechtsfragen des Ständerats als auch der Bundesrat die ursprünglich auf den Telefonverkauf beschränkte Initiative nun auf den gesamten Online-Handel ausdehnen wollen. Sie begründen dies mit einer Informationsasymmetrie betreffend die Qualität der Kaufsache und mit der Gefahr der Übereilung.
“Gleichzeitig besteht bei solchen Verträgen angesichts der heutigen technischen Möglichkeiten gerade im Online-Handel die erhöhte Gefahr, dass Konsumentinnen und Konsumenten solche Verträge übereilt abschliessen oder sich der damit verbundenen Konsequenzen nicht genügend bewusst sind.”
Man kann sich durchaus fragen, ob es nicht der Bundesrat und die Kommissionsmehrheit sind, die nun übereilt eine Änderung des Obligationenrechts einleiten. Die Gefahr eines Marktversagen wird nur behauptet. An einer Substanziierung oder an Belegen fehlt es in den Unterlagen gänzlich. Bei dieser schwachen Datenbasis könnte man auch die Meinung vertreten, die freiwillige Gewährung des Widerrufsrecht sei heute bereits die Basis eines erfolgreichen Onlinehändlers und eine gesetzliche Vorschrift daher unnötig. Sodann erscheint die "digital literacy" des Konsumenten nicht zwingend als so bescheiden, wie es der Bundesrat darstellt. Sowohl die pauschale Behauptung von Marktversagen als auch das wenig schmeichelhafte Konsumentenleitbild des Gesetzgebers wurden schon früher in diesem Blog angeprangert.
Nach Ansicht des Bundesrates (Stellungnahme, S. 9) lassen sich die Kosten der neuen Regulierung zwar "nicht quantifizieren [..., doch] hält der Bundesrat diese insgesamt für verkraftbar und zugunsten eines verbesserten Konsumentenschutzes auch für gerechtfertigt." Auch diese Aussage ist in keiner Weise belegt. Die dem Konsumenten für das Widerrufsrecht entstehenden Kosten bestehen vor allem in den höheren Preisen, die er für Produkte im Online-Handel bezahlen wird. Der überlegte Konsument wird nämlich all die anderen quersubventionieren, die frivol einkaufen im Wissen, alles später - immerhin kostenpflichtig - zurücksenden zu können. Offensichtlich stellt der Änderungsvorschlag nur einen Teil der Konsumenten besser, nämlich die leichtfertigen.
Die nun vorgeschlagene Regelung umfasst 11 umständlich zu lesende und schwierig zu verstehende Artikel. Der Regulierungsumfang wird gegenüber der heutigen Regelung der Haustürgeschäfte verdoppelt. Der Entwurf ist offensichtlich durch das europäische Recht inspiriert, das hier ganze 25 Seiten umfasst. Europakompatibilität kann jedoch kein Ziel an sich, sondern nur ein Mittel zur Erreichung höherer Ziele sein, insbesondere der Förderung der Gesamtwohlfahrt. Eine solche fördernde Wirkung ist hier nicht erstellt.